Lange Zeit hat man gehofft, dass der Wachstumsfaktor Erythropoietin (EPO) in der Lage ist, sehr unreife Frühgeborene vor neurokognitiven Langzeitfolgen zu bewahren. Immerhin unterstützte die Metaanalyse von fünf randomisiert-kontrollierten Studien bei sehr unreifen Frühgeborenen diese Annahme. Doch weder die groß angelegte prospektive PENUT-Studie (Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial) noch der Swiss EPO Neuroprotection Trial (NCT 00413946) konnten im Alter von zwei Jahren einen signifikanten Vorteil für die mit EPO behandelten Kinder im Vergleich zur Placebogruppe ausmachen. Dabei hatten MRT-Untersuchungen, die bei einer Subgruppe der Teilnehmer des Swiss EPO Neuroprotection Trials im Alter von 40 Wochen postmenstruell durchgeführt worden waren, bei den Kindern im Interventionsarm weniger Schädigungen der grauen und der weißen Substanz nachgewiesen. Darüber hinaus waren bei ihnen die weiße Substanz sowie die strukturelle Konnektivität generell besser entwickelt als bei den Kindern im Placeboarm. Doch da sich diese Unterschiede nicht auf das neurokognitive Outcome im Alter von zwei Jahren ausgewirkt hatten, nahmen die Forscher an, dass der Untersuchungszeitpunkt mit zwei Jahren zu früh gewählt sein könnte, um potenzielle Unterschiede valide zu zeigen.
Dieser Fragestellung widmete sich die EpoKids-Studie, deren Ergebnisse nun vorliegen. Dabei wurden 214 frühere Studienteilnehmer des Swiss EPO Neuroprotection Trials im Alter von durchschnittlich 10 Jahren (Altersspanne: 6,9–13,4 Jahre) nachuntersucht. Bei allen handelte es sich um ehemalige Frühgeborene mit einem Gestationsalter von median 29 Wochen und einem durchschnittlichen Geburtsgewicht von 1200 Gramm. Von diesen hatten 117 als Verum-Gruppe perinatal eine EPO-Prophylaxe erhalten, während die übrigen 97 dem Kontrollarm zugelost worden waren. Zusätzlich wurde für die EpoKids-Studie eine Kontrollgruppe mit 167 reifgeborenen Gleichaltrigen rekrutiert.
Alle Teilnehmer der EpoKids-Studie unterzogen sich umfassenden neuropsychologischen Untersuchungen inklusive IQ-Tests, erhielten ein kraniales MRT und füllten Fragebögen aus. Auch die Einschätzung der Eltern wurde mittels Fragebogen erfasst.
In keinem der Items der neuropsychologischen Testung fanden die Untersuchenden einen signifikanten Unterschied zwischen den mit EPO behandelten ehemaligen Frühgeborenen und der Placebogruppe. Doch verglichen mit den Reifgeborenen lagen ihre Scores für die exekutiven Funktionen ebenso wie für die Verarbeitungsgeschwindigkeit generell niedriger.
Warum die EPO-Prophylaxe nicht den gewünschten Erfolg hatte, ist unklar. Man könnte vermuten, dass die Behandlung mit drei hochdosierten Gaben von rekombinantem EPO, die während der ersten 42 Lebensstunden verabreicht worden waren, nicht lange genug fortgesetzt worden war, um ihre protektive Wirkung zu entfalten. Denn immerhin erstrecken sich die sekundäre und tertiäre Phase der neonatalen Hirnschädigung über Wochen und Monate, möglicherweise sogar Jahre. Doch dieses Argument wird durch die Ergebnisse der PENUT-Studie relativiert, in der die EPO-Behandlung immerhin bis zum Ende der 32. Woche postmenstruell fortgesetzt worden war und bei der im Alter von 2 Jahren ebenfalls kein neuroprotektiver Effekt gezeigt werden konnte. Ob eine fortgesetzte Gabe bis über den errechneten Geburtstermin hinaus das Langzeit-Outcome verbessern könnte, müsste mithilfe weiterer Studien geklärt werden.
Darüber hinaus hat die EpoKids-Studie die Teilnehmerzahl von 296, auf der die statistischen Planungen basierten, nicht erreicht. Dies könnte die statistische Power zu stark vermindert haben, um potenzielle Differenzen zwischen den Gruppen aufzudecken.
Doch letztendlich muss man möglicherweise der Tatsache ins Auge blicken, dass EPO einfach nicht die neuroprotektive Potenz besitzt, die man sich von der Substanz erwartet hat. Generell dürften solche Einzelmaßnahmen der Komplexität der Frühgeburtsproblematik nicht gerecht werden. Daher sollten zukünftige Untersuchungen statt isolierter Interventionen eher Maßnahmenbündel in den Fokus nehmen, die neben pharmakologischen auch nicht-pharmakologische Optionen und Umgebungsfaktoren umfassen, so das Fazit der Autoren.





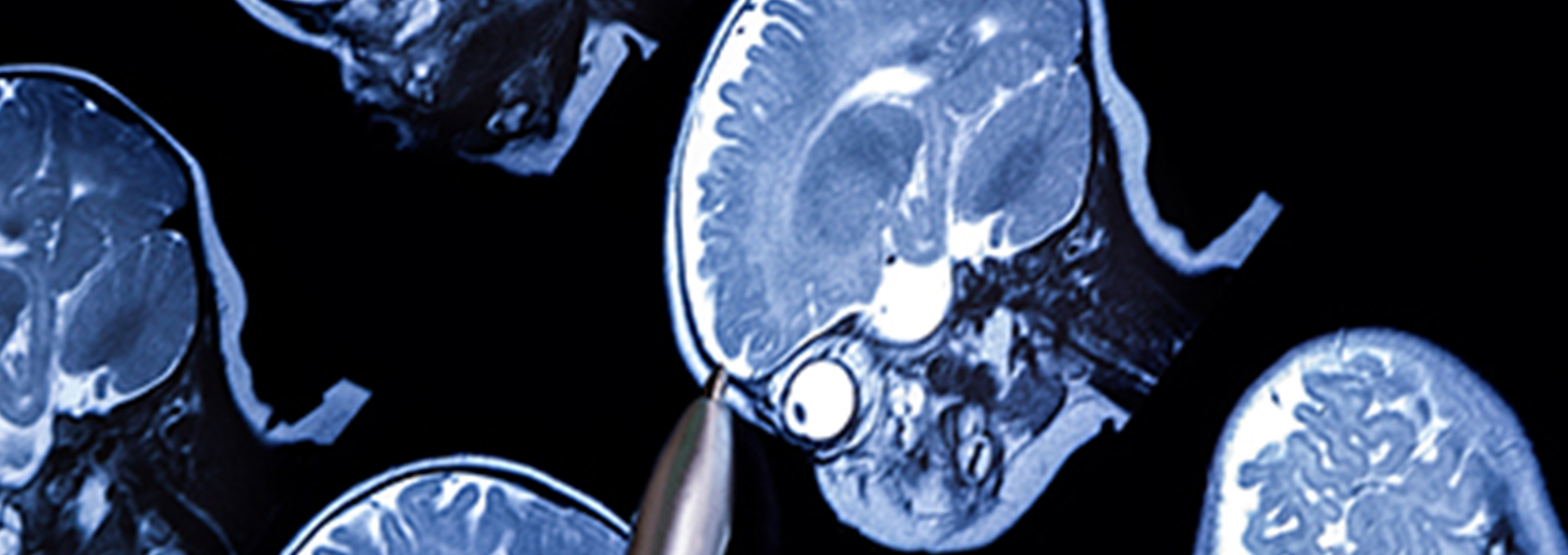
Inhalt teilen